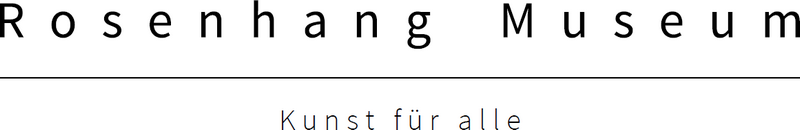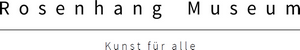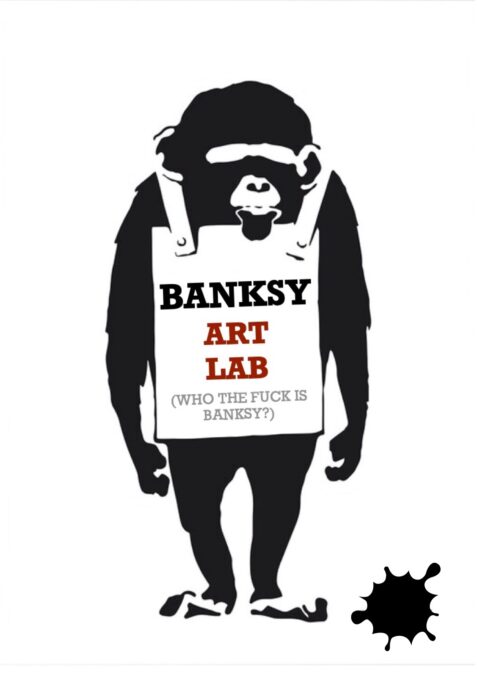Die dritte Natur
Ein Ausstellungsprojekt von Stephan Kaluza und Jiny Lan
Vernissage 15.06.2025, 15 h
Ausstellung vom 15.06.-07.09.2025
Was ist Natur; wie visualisiert sich Natur in den Künsten? Das ist wohl die treibende Frage hinter dem Konzept von Kaluza und Lan.
Ein Gedanke dazu:
Unter einer ersten Natur mag eine von frühen Menschen unmittelbar erlebte Welt gemeint sein, die Teil der Naherfahrung Natur waren; eine Gesellschaft, die die Natur nicht nur physisch, sondern auch spirituell und emotional als Ereigniskette erlebten.
Die zweite Natur begrenzt sich bereits auf einen objekthaften und auch utilitaristischen Charakter; die Natur wird zur Ressource, zur Lebensgrundlage, zu einer Umwelt. Die Sprache rückt sie in eine konträre Position zur Kultur; die Natur wird zugunsten der Kultur ersetzbar.
Eine Kultur allerdings, die alles andere als frei von Sehnsüchten nach eben jener verloren Frühzeit ist; eine Kultur, die ihrerseits wieder eine „künstliche“ Idyllnatur entwickelt, eine dritte Natur der Künste, eine reine Menschennatur, die per Eskapismus und totalisierter Immersion wiederum an die Urbilder einer ersten Natur anknüpft.
Oder auch: Anknüpfen muss. Denn diese beständige Sehnsucht verrät nicht weniger als eine Abhängigkeit von der Natur, die kaum noch zu leugnen ist.
Die Arbeiten von Stephan Kaluza und Jiny Lan werden diesen Ansatz, die sichtbare Natur zwischen Idyll und Immersion, thematisieren. Parallel soll es Veranstaltungen und Vorträge geben, die sich mit einer -zukünftigen- Natur und Naturdarstellung auseinandersetzen. Eine Ausstellung also, bei der Inhalt und Thematik im Vordergrund stehen sollen.
„The Disappeared“ von Stephan Kaluza, 170 x 300 cm, zweiteilig, 2024, Öl auf Leinwand
Stephan Kaluza
1964 in Bad Iburg geboren.
1986 – 1994 Studium an der FH Düsseldorf, Kunstakademie Düsseldorf, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
Lebt und arbeitet in Düsseldorf
Preise
Art Chicago 2003
ARCO 2004
George Konell Preis der Stadt Wiesbaden, 2005
Carl Lauterbach-Preis der Carl – und Ruth Lauterbach-Stiftung, Düsseldorf, 2005
Kunstpreis des FBZ, Bochum 2019

„Color Palette 1“ von Jiny Lan, 200 x 280 cm, 2024, Mixed Media on Canva
Name: Jiny Lan
Born: 1970, Xiuyan, Liaoning (CN)
Education:
1991-1994 – Studied at China Academy of Fine Arts, Zhejiang (CN)
1988-1991 – Studied economics at Bohai University, Liaoning (CN)
Professional background:
Since 2017 – International Section Director of the Chinese art magazine „National Arts“
2013 – Co-curator for the exhibition“Social Sculpture- Beuys in China“ in CAFA Museum Beijing (CN)
2006-2009 – Project Coordinator Foundation Museum Schloss Moyland
Since 1996 – Freelance artist
1995 – Immigration to Germany
1994-1995 – Art Editor at People’s Daily, Beijing (CN)
Awards:
2024 – Jiny Lan Art Foundation, founded by the city of Düsseldorf
2023 – Löwe von Weilburg, (endowed with 60.000€)
Permanent exhibitions:
2021 – Inclusion in the art collection of the German Bundestag
2023 – Himmelsfragen, Rosenhang Museum, Weilburg (DE)